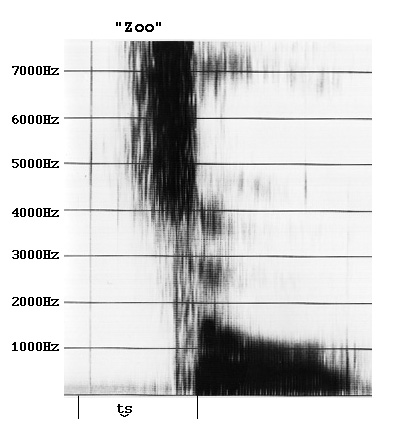Während erster, zweiter und dritter Formant vokalspezifisch sind, d.h. relativ sprecherunabhängig immer annähernd gleiche Frequenzwerte annehmen, sind die Frequenzwerte ab dem vierten Formanten überwiegend für Klangfarbe und Charakterisitk der Sprecherstimme verantwortlich. Sie dienen in erster Linie der Identifikation eines Sprechers und nicht eines Vokals.
Daher werden wir uns bei der Vokalidentifikation im Sonagramm ebenfalls nur auf die ersten drei, meist sogar nur die ersten beiden Formanten konzentrieren. Der Verlauf des dritten Formanten wird uns zuweilen helfen, die Artikulationsstelle eines angrenzenden Konsonanten, meist Nasal oder Plosiv, zu erkennen.
Die Formanttabelle in Abbildung 2V.1 zeigt die bei Männern (M), Frauen (W) und Kindern (Ch) durchschnittlich gemessene Grundfrequenz F0 und die Frequenzwerte der drei ersten Vokalformanten.
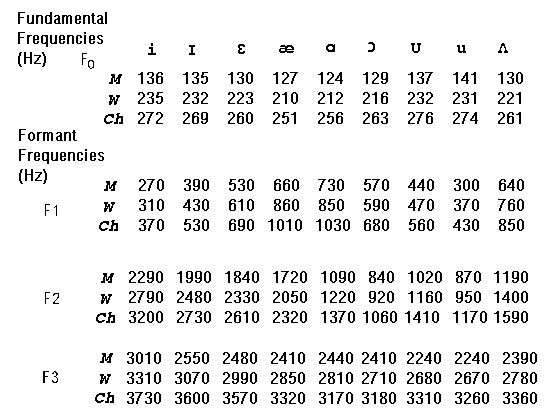
Abb. 2.1: Formanttabelle mit Grundfrequenz F0 und F1, F2, F3 der Vokale, gemittelt über 76 Sprecher: Männer (M), Frauen (W) und Kinder (Ch). (entnommen aus: PETERSON, BARNEY, 1952, S.183)
Abb. 2.2: "Biedermeier" mit Vokal-Kennzeichnung [i],[A],[aI A]
Die sehr häufige silbenfinale r-Vokalisation nach einem Vokal wie z.B. in "Uhr"
[u
Das Sonagramm der Äußerung "Da ist mein Neuhaus" in Abbildung 2.3
zeigt die gleitenden Formantübergänge (Transitionen) der Diphthonge. Zu
sehen ist außerdem die monophtongische Vokalfolge /a-i/. Wir beobachten zwar
ebenfalls einen Übergang der Formanten vom /a/ zum /i/, doch weisen hier die
beiden Vokale wesentlich längere quasikonstante Phasen auf, wohingegen der
folgende Diphthong [aI] fast ausschließlich aus Transitionen besteht.
Abb. 2.3: "Da ist mein Neuhaus" mit markierten Diphthongen [aI
Der sog. harte Stimmeinsatz hängt jedoch unabhängig von Akzentuierung
und Pausensetzung auch von der Vokalqualität ab und korreliert mit dem
Öffnungsgrad des Vokals. Damit tritt der Glottal-Stop am häufigsten vor
/a/, am seltensten vor /i/, /u/ und /y/ auf. (Siehe Kapitel 2.3 "Der Glottal Stop")
Mit der Verschlußbildung (Phase I) erfolgt ein abrupter Abfall der spektralen
Energie. Die Verschlußphase (Phase II) zeichnet sich durch eine völlige
'akustische Stille' in allen Frequenzbereichen des Spektrums aus, abgesehen von einem
eventuell vorhandenen Stimmton. Dieser ist als 'voice bar' im untersten
Frequenzbereich des Sonagramms zu sehen. Während der Verschlußphase
eines stimmhaften Plosivs schwingen die Stimmlippen so lange weiter, bis der
Luftdruck im Mundraum groß genug ist, die Phonation zu stoppen oder aber der
Verschluß gelöst wird. Das erklärt den nicht immer durchgehenden
Stimmton bei stimmhaften Plosiven.
Die Verschlußlösung, der Burst (Phase III), hat einen plötzlichen,
sprunghaften Anstieg der spektralen Energie in einem bestimmten Frequenzbereich
zur Folge. Dieser ist bestimmt durch die Burst-Schallquelle, also der
Artikulationsstelle des Plosivs. Das Verschlußlösungsgeräusch
stimmhafter Plosive ist mit einer Dauer von nur 10-20 ms sehr kurz. Ihm folgt eine
sehr schnelle F1-Transition von ca. 50 ms. Bei
stimmlosen Plosiven ist der Burst in der Regel gefolgt von einer Aspirationsphase
unterschiedlicher Dauer. Diese liegt etwa zwischen 40 ms und 80 ms.
Die Aspiration entfällt bei stimmlosen Plosiven in Verbindung mit Frikativen
und vor Nasalen.
Plosive sind im Sonagramm in der Regel anhand ihrer Verschlußphase sehr gut
zu erkennen, da während dieser Phase quasi eine 'Lücke' im Sonagramm
auftritt. Auch bei stimmhaften Plosiven herrscht oberhalb von etwa 500 Hz absolute
Stille, da Stimmlippenschwingungen nur im untersten Frequenzbereich (d.h. im
Bereich der F0 und den ersten Harmonischen) über Kehlkopf und
Körpergewebe abgestrahlt werden können.
Diese Stille gilt als notwendiges akustisches Merkmal für die Perzeption eines
Plosivs. Fehlt sie, kann kein Plosiv wahrgenommen werden. Das läßt sich
direkt auf die visuelle Darstellung übertragen. Fehlt die 'akustische Stille', d.h.
die 'Lücke' im Sonagramm, ist es fast unmöglich, einen Plosiv
wahrzunehmen, es sei denn, ein Burst läßt sich zweifelsfrei erkennen.
Zu diesem Phänomen sind jedoch einige Anmerkungen notwendig. Geht einem
stimmhaften Plosiv ein Nasal voraus, kann diese 'Stille' auf wenige Millisekunden
reduziert werden, besonders wenn Nasal und Plosiv homorgan sind, d.h. dieselbe
Artikulationsstelle haben. Im Extremfall kann der Plosiv nicht mehr vom Nasal
getrennt werden, wenngleich er auditiv wahrnehmbar ist (vgl. dazu auch im Kapitel
4.2 "Leicht zu verwechselnde Laute" die sonagraphische Gegenüberstellung [d]
vs. [nd] vs. [n].)
Das Sonagramm in Abbildung 2.4 zeigt die stimmhaften Plosive [d] und [g] und
zweimal den stimmlos aspirierten Plosiv [th] in der Äußerung "das gute
Boot".
Abb. 2.4: "das gute Boot" mit den stimmhaften Plosiven [d] und [g] und dem stimmlos
aspirierten Plosiv [th]
Die Verschlußphase stimmhafter Plosive ist meist kürzer als die der
stimmlosen und auch ihr Burst ist wesentlich
schwächer. Während der Produktion stimmloser Plosive wird hinter dem
Verschluß ein wesentlich stärkerer Druck aufgebaut, was einen Burst
höherer Intensität zur Folge hat.
Die anstelle der stimmhaft/stimmlos-Unterscheidung vorgeschlagene, perzeptiv
wahrnehmbare 'fortis-lenis'-Unterscheidung ist beim Lesen von Sonagrammen wenig
hilfreich, da sich der fortis-lenis-Unterschied akustisch allenfalls in minimalen
Intensitätsunterschieden bei der Verschlußlösung bemerkbar macht.
Diese sind im Sonagramm selten erkenn- oder gar meßbar.
Die Sonagramme in Abbildung 2.5 zeigen die reduziert produzierten
Äußerungen "Abend, bettelt" mit velarer und lateraler
Verschlußlösung [bm] und [tl]. Auch hier ist der Burst noch deutlich zu
erkennen.
Abb. 2.5: "Abend" mit velarer Verschlußlösung [bm] und "bettelt" mit
lateraler Verschlußlösung [tl].
Abb. 2.6: Der 'Glottal-Stop' jeweils zu Beginn von "am" und "also", [?]
markiert
Anstelle des Glottal-Stops beobachtet man häufig einen sog.
Glottalisierungseffekt zu Beginn des Vokals. Mit Glottalisierung wird eine
unregelmäßige Glottisschwingung bei niedriger Schwingungsfrequenz
bezeichnet. In der Regel wird das Phänomen der Glottalisierung perzeptiv gar
nicht wahrgenommen. Im Sonagramm aber ist es nicht zu übersehen. Das
kurzzeitige rasche Abnehmen der Schwingungsfrequenz (Absinken der Grundfrequenz
F0) zeigt sich dort durch deutlich größere Abstände zwischen den
einzelnen Glottisschlägen. Die Formantstruktur der Glottisschläge
während der Glottalisierungsphase entspricht der des Vokals, denn die
Ansatzrohrkonfiguration bleibt unverändert.
Abbildung 2.7 vergleicht den einsilbigen Namen "Bea" mit dem zweisilbigen "Beate",
wobei wir beim zweiten Namen einen silbeninitialen Glottal-Stop vor dem /a/ erwarten
würden. Die erste Äußerung zeigt einen fließenden
Übergang zwischen den Vokalen /e/ und /a/, während in der zweiten der
Glottal-Stop durch einen glottalisierten Übergang ersetzt wird.
Abb. 2.7: "Bea" vs. "Be?ate": Glottalisierung ersetzt den Glottal-Stop
Eine Glottalisierung ("creaky voice") erfolgt häufig auch bei Konsonant-Vokal-
Übergängen, wenn z.B. dem silbeninitialen Vokal ein Nasal oder ein
Lateral vorausgeht. In diesem Fall beginnt die Glottalisierung bereits gegen Ende des
vorausgehenden Nasals oder Laterals.
Abbildung 2.8 zeigt den glottalisierten Übergang vom Nasal /m/ zum Folgevokal
/a/ in der Äußerung "am Abend" und vom Lateral zum
Folgevokal /e/ in der Äußerung "Schulessen".
Abb. 2.8: Glottalisierung von Nasal und Lateral in den Äußerungen
"am~Abend" und "Schul~essen", Übergang markiert
Neben den Möglichkeiten Glottal-Stop und Glottalisierung finden wir weitere
Realisierungen, die weder der einen noch der anderen Kategorie zugeordnet werden
können, sondern dazwischen liegen.
Die stufenweise Reduktion des glottalen Verschlußlautes bis hin zur
Glottalisierung wollen wir uns nun im Zeitsignal ansehen. Abbildung 2.9 zeigt dies am
Beispiel der Äußerung "arbeitet" bei vorausgehendem Vokal.
Abb. 2.9: Zeitsignal (5x) zeigt die stufenweise Reduktion des [
Beim ersten Signal ist der Glottal-Stop deutlich ausgeprägt. Das zeigt sich im
Ansetzen der glottalen Anregung nach einer deutlichen Signalpause. Bei den
nächsten Realisierungen wird die Pause weiter verkürzt. Dennoch zeigt
sich bei diesen Reduktionen ein Reflex des ursprünglichen
Verschlußlautes, der als Störung im periodischen Ablauf der
Kehlkopfanregungen zu erkennen bleibt.
Solches Stimmverhalten kann als Indiz für das Vorliegen einer Wort- oder
zumindest einer Silbengrenze herangezogen werden. Bei unbetontem Anfangsvokal
kann dieser letzte Hinweis auch ganz wegfallen, wie das Sonagramm in Abbildung 2.10
zeigt. Wir sehen einen nahtlosen Übergang der Vokalfolge /e-i/ zwischen den
beiden Wörtern "suche ich".
Abb. 2.10: nicht-glottalisierter, diphtongisierter Übergang /e-i/ in der
Äußerung "suche ich",
[
Glottalisierung tritt jedoch nicht nur als Reduktionsphänomen anstelle des
Glottal-Stops auf. Eine Glottalisierung beobachten wir ebenfalls an weitgehend
beliebiger Stelle einer Äußerung und natürlich im Rahmen des
Phänomens 'prefinal lengthening'.
Mit 'prefinal lengthening' wird eine zeitliche Dehnung der Laute am Satzende bzw.
äußerungsfinal bezeichnet. Neben einer Dehnung der Vokale finden wir
hier häufig eine deutlich erkennbare, unter der sprecherüblichen F0
liegende Stimmlippenschwingung, die zudem oft unregelmäßig ist.
Der Verschluß im Mundraum wird analog zu den Plosiven gebildet. Die
Bewegung von Zunge oder Lippen erfolgt schnell. Es wird ein kompletter
Verschluß gebildet. Während der Verschlußphase strömt der
Glottisschall durch den Nasenraum nach außen, so daß sich - anders als
bei den Plosiven - kein Druck im Mundraum aufbauen kann. Aus diesem Grund
entsteht bei der oralen Verschlußlösung kein
Verschlußlösungsgeräusch. Aufgrund des geringeren oralen
(supraglottalen) Drucks wird der Verschluß außerdem langsamer
gelöst als beim Plosiv.
Während der Verschlußphase bilden sich im Vokaltrakt aufgrund des
zugeschalteten Nasenraums sog. Anti-Formanten aus, die Teile des Spektrums sehr
stark dämpfen. Der durch die Nase ausströmende Schall hat ein
überwiegend niederfrequentes Spektrum, bedingt durch die Hauptresonanz der
großvolumigen nasalen Passage und die starke Verengung an den
Nasenöffnungen
Hauptkennzeichen eines Nasals im Sonagramm ist ein stark gedämpftes
Formantspektrum oberhalb etwa 500 Hz. Der erste Formant F1 liegt bei ca. 250 Hz
und dominiert das Spektrum. F2 ist sehr schwach ausgeprägt oder fehlt
völlig. Mehrere höhere Formanten geringer Intensität sind
manchmal zu erkennen. Einer von ihnen liegt bei etwa 2200 Hz
Die Anti-Formanten des Nasals sind besonders in Vokalumgebung gut erkennbar
durch einen starken Energieabfall im Spektrum zu Beginn des Nasals: am Ende des
Vokals erfolgt ein starker Amplitudenabfall und ein abrupter Wechsel der
Formantstruktur.
Die Nasale des Deutschen sind stimmhafte Laute, beginnen jedoch nach stimmlosen
Frikativen meist stimmlos.
Abbildung 2.11 zeigt die drei Nasale des Deutschen in den Äußerungen
"anga" (Ohne [g] gesprochen), "ana" und "ama". Dort ist zu sehen, wie klar sich Nasale von Vokalen abgrenzen lassen, was
die Segmentierung erleichtert.
Abb. 2.11: [aNa, ana, ama] mit den drei Nasalen des Deutschen [
Durch den bei der Nasalierung hinzugeschalteten Nasaltrakt werden im Vokaltrakt
zusätzliche Resonanzen und Antiresonanzen erzeugt. Diese
Veränderungen sind jedoch überwiegend auf die veränderten
Filtereigenschaften des Vokaltrakts zurückzuführen und nicht durch den
zusätzlich durch die Nase ausströmenden Sprachschall verursacht. Der
austretende Nasenschall kann aufgrund seiner im Vergleich zum Vokal geringen
Amplitude oberhalb von 500 Hz in der Regel vernachlässigt werden.
Das Vokalspektrum erfährt durch die Nasalierung folgende
Veränderungen.
Das Sonagramm in Abbildung 2.12 vergleicht die beiden Äußerungen "bei"
und "Mai" (entnommen aus PICKET, 1980, S.124). Das [a] in der ersten
Äußerung ist nicht nasaliert, denn F1 und F3 sind mit normaler
Amplitude gut zu erkennen. Der erste Formant weist Transitionen vom [b] zum [a]
auf. Das [a] der zweiten Äußerung dagegen ist nasaliert, zu erkennen an der
gedämpften Amplitude des F1 und dem durch Antiresonanzen nahezu
ausgelöschten F3.
Abb. 2.12: Nasalierung anhand "bei" vs. "Mai". Die Nasalierung des [a] in "Mai" ist zu
erkennen am gedämpften F1 und am durch Antiresonanzen nahezu
ausgelöschten F3.
Was den Grad der artikulatorischen Konstriktion betrifft, besitzt das /l/ sowohl
'vokalische' als auch 'konsonantische' Eigenschaften. Der alveolare Teil-Verschluß mit der Zungenspitze und die Verengung in der Uvulagegend geben
dem /l/ im Sonagramm seine konsonantischen Eigenschaften: der erste Formant F1
liegt tief. Zudem dämpfen Antiresonanzen die Amplitude der Formanten im
Vergleich zu den Vokalen. Allerdings ist diese Dämpfung viel weniger stark
ausgeprägt als bei den Nasalen. Durch die seitlich offenen Passagen bekommt
das /l/ seine meist klare Formantstruktur, die es einem Vokal oft zum Verwechseln
ähnlich aussehen läßt.
Liegt uns ein vokalähnliches Segment mit den
ungefähren Formantwerten F1 < 500 Hz und F2 = 1800 Hz vor, handelt es sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit um einen Lateral. Als weiteren Hinweis auf einen Lateral können
wir vereinzelte Verschlußlösungen (der Zungenspritze!) an den
Segmentgrenzen des Laterals oder sogar im Lateral selbst (der Zungenspitze) werten.
Die Sonagramme in Abbildung 2.13 zeigen den Lateral in vokalischer Umgebung /a, i,
u/.
Abb. 2.13: [ala] [ili] [ulu], der Lateral in Vokalumgebung
Abb. 2.14: Der Lateral in "Blume": F2 liegt hoch zwischen 1800 und 2000 Hz.
In "Blume" weist der Lateral einen hohen zweiten Formanten auf, obwohl sowohl der
vorausgehende Plosiv [b] einen Lokus von unter 1000 Hz hat, als auch der zweite
Formant des nachfolgenden Vokals [u] unter 1000 Hz liegt.
Einen hohen zweiten Formanten von etwa 1800 Hz finden wir beim /l/ ebenfalls, wenn
vordere Vokale angrenzen. Bei knapp 2000 Hz liegt er vor Nasalen und nach
unbetonten Vokalen, was in den Sonagrammen der Äußerungen "Ulm",
"Alm" und "belebt" in Abbildung 2.15 zu sehen ist.
Abb. 2.15: Der F2 des Laterals in "Ulm, Alm, belebt" liegt hoch bei etwa 1800 Hz.
Die Untersuchung zeigt eine sehr starke Streuung der Formantwerte für jeden
der Vokale, wenngleich der höchste F1 vor dem Vokal [a] mit dem
höchsten F1 und der höchste F2 vor dem Vokal [i] mit dem
höchsten F2 gemessen wurde.
Für die Laterale des Englischen geben DALSTON (1974
Abb. 2.16: Zwei Varianten von "Pilz" (kölsch und hochdeutsch): [p
Für die sich deutlich widersprechenden Werte für den dritten Formanten
bei DALSTON und FAURE möge eine Erläuterung FANTs (1970
Aufgrund ihrer physiologischen Bildungsweise sind beim Trill zwei Phasen besonderer
Strukturierung zu unterscheiden: eine offene Phase und eine Verschlußphase.
Jeder Schlag des Trills besteht aus diesen zwei Phasen. Während der offenen
Phase wird ein Maximum an Phonationsschall abgestrahlt, da in dem Moment die
Zungenspitze den größten Abstand von den Alveolen hat bzw. die Uvula
die weiteste Auslenkung erfährt. Während der Verschlußphase ist
die alveolare bzw. uvulare Passage maximal verkleinert und dämpft so den
Phonationsstrom kurzzeitig auf ein Minimum.
Der Übergang von der
Verschlußphase zur Öffnungsphase erfolgt schneller als im umgekehrten
Fall, da das Artikulationsorgan hier durch den Phonationsstrom unterstützt
wird. Der alveolare Verschluß bzw. die uvulare Enge dagegen wird gegen den
Phonationsstrom gebildet. Im Sonagramm zeigt sich dieser Zusammenhang durch eine
etwas längere Öffnungsphase im Vergleich zur Verschlußphase.
Diese beiden artikulatorisch sehr verschiedenen Phasen sind auch im Sonagramm sehr
gut voneinander zu unterscheiden. Das akustische Produkt ist ein mit der Frequenz des
Verschlusses amplitudenmodulierter Vokal. Seine Frequenz liegt etwa zwischen 23 Hz
und 26 Hz
Abb. 2.17: Der alveolare Trill [r] in "Ara"
Das erzeugte Friktionsgeräusch, das akustisch etwa dem weißen Rauschen
entspricht, wirkt als akustische Anregung für beide Resonanzräume. Es
wird jedoch überwiegend im vorderen Mundraum moduliert, so daß das
Spektrum des am Mund abgestrahlten Frikativschalls weitgehend von
Größe und Form des vorderen Resonanzraumes abhängt.
Generell gilt, je größer der vorderer Resonanzraum ist, d.h. je weiter
hinten die Artikulationsstelle, also der Ort der Engebildung, liegt, desto stärker
wird der Schall moduliert und umso ausgeprägter ist sein Spektrum.
Während also beim labiodentalen [f] das Spektrum sehr flach ist, weist das
velare [x] bereits formantähnliche Strukturen auf.
Frikative sind im Sonagramm anhand ihrer 'Geräuscheigenschaften' meist sehr
leicht zu erkennen und zu segmentieren. Sie zeichnen sich durch eine stochastische
Schwärzung besonders im oberen Frequenzbereich aus. Das Frikativspektrum
weist wesentlich mehr Intensität in den höheren Frequenzbereichen
oberhalb von 2500 Hz auf als in den unteren Frequenzbereichen. Je nach
Artikulationsort konzentriert sich dieses 'Rauschen' auf bestimmte Frequenzbereiche.
Das Sonagramm in Abbildung 2.18 zeigt die Äußerung "Fachschaft" mit
den markierten Frikativen [f], [x], [
Abb. 2.18: Frikative [f], [x], [
Ein stimmhafter Frikativ weist eine geringere Intensität auf als ein stimmloser.
Hinzu kommt bei stimmhaften Frikativen der 'voice bar' der zugeschalteten
Glottisschallquelle.
Stimmhafte Frikative können sowohl äußerungsinitial als auch in
stimmloser Umgebung ganz oder teilweise entstimmt produziert sein. Das zeigt sich
im Fehlen des 'voice bar'. Die für stimmhafte Frikative typische geringe
Intensität bleibt dabei jedoch meistens als Erkennungsmerkmal seiner
'ursprünglichen' Stimmhaftigkeit erhalten.
Abb. 2.19: Affrikate [ts] gefolgt von [o] Abgrenzung der Vokale von den Konsonanten
Vokale unterscheiden sich im Sonagramm von Konsonanten in erster Linie durch ihre
deutliche Formantstruktur. Da jedoch auch Lateral und Nasal mehr oder weniger
ausgeprägt Formantstrukturen aufweisen, ist eine Abgrenzung von ihnen an
dieser Stelle notwendig, um Verwechslungen auszuschließen. Wichtigstes
Unterscheidungsmerkmal ist dabei der bei den Konsonanten niedrigere erste Formant
F1. Er wird bedingt durch die größere artikulatorische Enge bei
Konsonanten im Vergleich zu Vokalen. Auf die Abgrenzung von Vokalen und
ähnlich aussehenden Konsonanten wird in Kapitel 4 ("Leicht zu verwechselnde Laute") näher eingegangen.
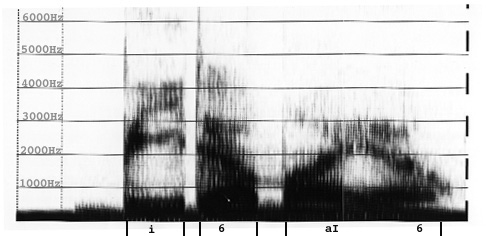
Diphthonge
Tritt eine deutlich wahrnehmbare Veränderung der Vokalqualität
innerhalb einer Silbe auf, so sprechen wir von einem Diphthong. Die für
Diphthonge typische kontinuierliche Veränderung der Vokalqualität zeigt
sich im Sonagramm durch einen gleitenden Übergang der Formanten vom
ersten zum zweiten Vokal. Im Deutschen finden wir die Diphthonge [aI], [aU] und
[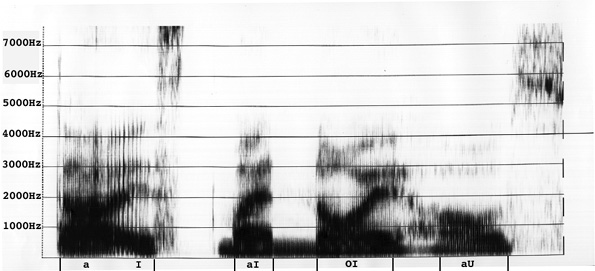
Vokale mit Glottal-Stop
Im Allgemeinen geht den Vokalen im Deutschen in wort- und silbeninitialer Position
ein glottaler Verschlußlaut, der 'Glottal-Stop' voraus. Er wird auch als harter
Stimmeinsatz bezeichnet.
Er steht potentiell vor jedem mit Vokal beginnenden Wort- und Stamm-Morphem,
sowie nach einer Sprechpause vor betontem und unbetontem Vokal bei
intramorphematischen Vokalfolgen /the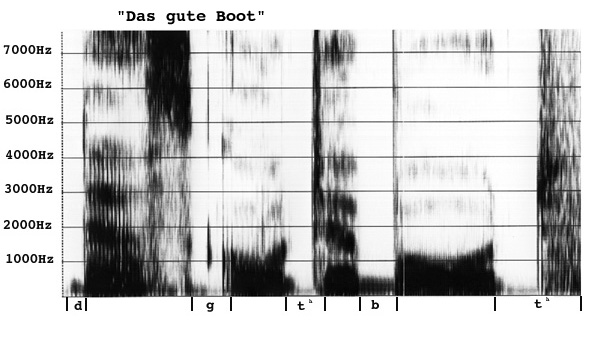
Unterscheidung stimmhafter, entstimmter von stimmlosen Plosiven
Neben dem 'voice bar' ist die Aspiration das wichtigste Merkmal, um die Phoneme /p/,
/t/ und /k/ äußerungsinitial und -medial von den Phonemen /b/, /d/ und /g/
zu unterscheiden. Ganz besonders deshalb, weil phonologisch stimmhafte Plosive
keineswegs immer stimmhaft realisiert werden, sondern oft teilweise oder völlig
entstimmt produziert werden. Das zeigt sich im Sonagramm am fehlenden oder
unterbrochenen 'voice bar'.
Velare und laterale Verschlußlösung
Wird bei einer homorganen Plosiv-Nasal-Folge die Verschlußlösung allein
durch das Senken des Velums bewirkt, spricht man von nasaler Plosion bzw. velarer
Verschlußlösung. In diesem Fall wird der Verschluß für
Plosiv und Nasal am gleichen Ort beibehalten.
Auch eine laterale Verschlußlösung ist möglich, wenn Plosiv und
folgender Lateral homorgan sind. Der Verschluß öffnet sich einfach durch
Senken der Zungenseiten in den Lateral.
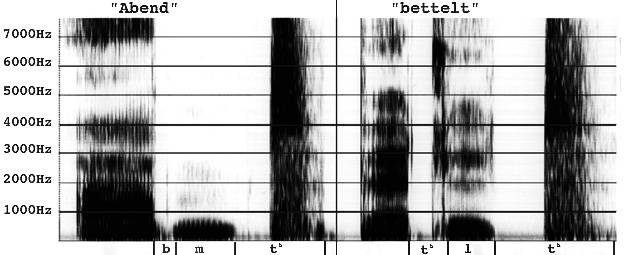
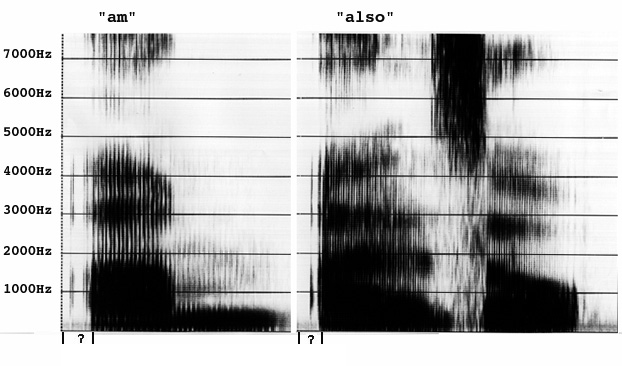
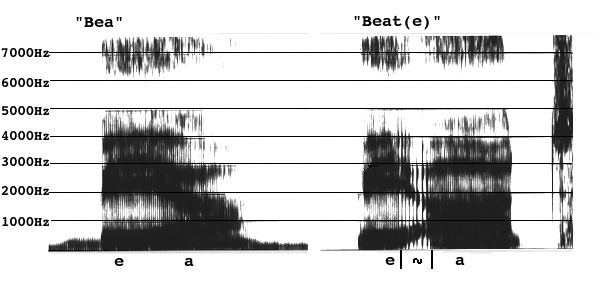
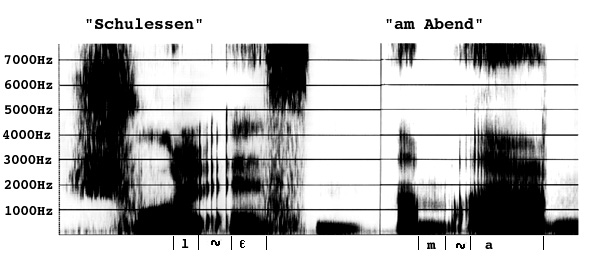
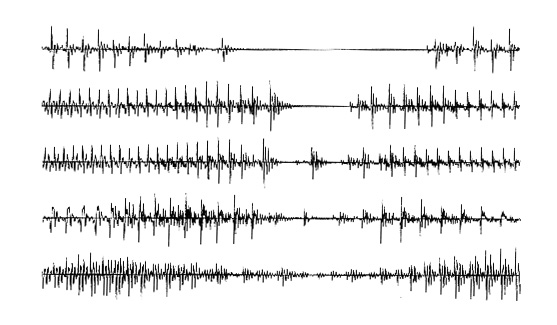
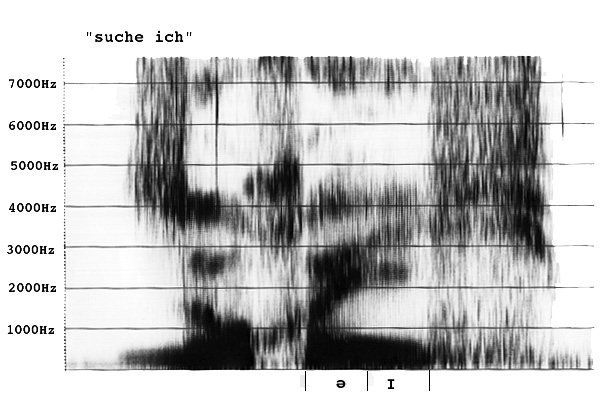
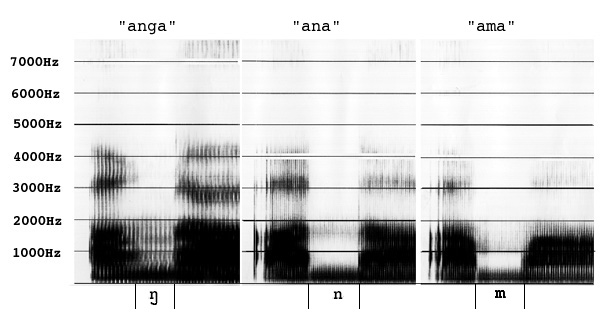
Nasalierung
Vokale können vollständig - wie es im Französischen üblich
ist - oder teilweise - wie oft im Deutschen an Vokal-Nasal- und Nasal-Vokal-Übergängen - nasaliert werden.
Das Absenken des Velums beginnt häufig schon zum Ende des Vokals ca. 100
ms bevor der orale Nasalverschluß (bilabial, alveolar oder velar) gebildet wird.
Das Velum wird erst wieder vollständig angehoben, wenn dieser
Verschluß bereits gelöst ist. Die Folge ist eine teilweise Nasalierung der
den Nasal umgebenden Vokale für eine Dauer von bis zu 100 ms
Die genauen Frequenzbereiche dieser Antiresonanzen hängen jedoch sehr stark
vom Grad der Nasalierung, also vom Grad der Velumöffnung ab.
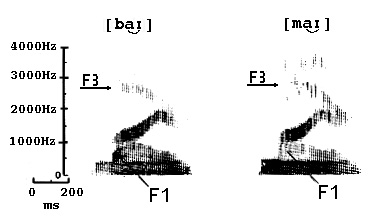
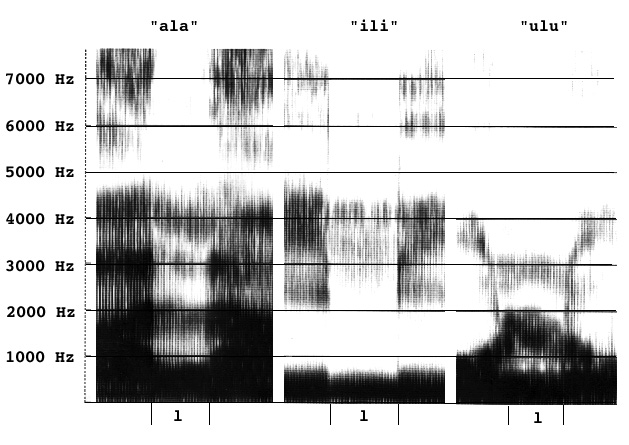
Laterale in verschiedenen Kontexten
Der relativ frei bewegliche Zungenrücken und besonders eine
kontextabhängige Lippenrundung machen den Lateral 'anfällig' für
koartikulatorische Effekte. Diese zeigen sich in der recht variablen Lage seiner
Formanten. Die Formantwerte des /l/ variieren je nach vokalischer und
konsonantischer Umgebung
F1: 350 Hz - 550 Hz
F2: 1000 Hz - 2000 Hz
F3: 2500 Hz - 3000 Hz
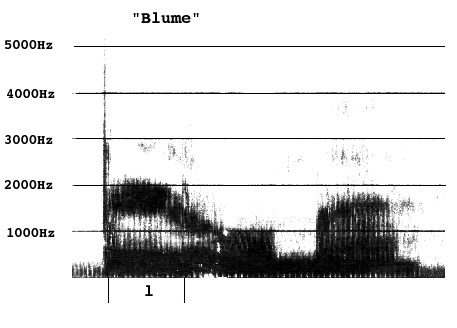
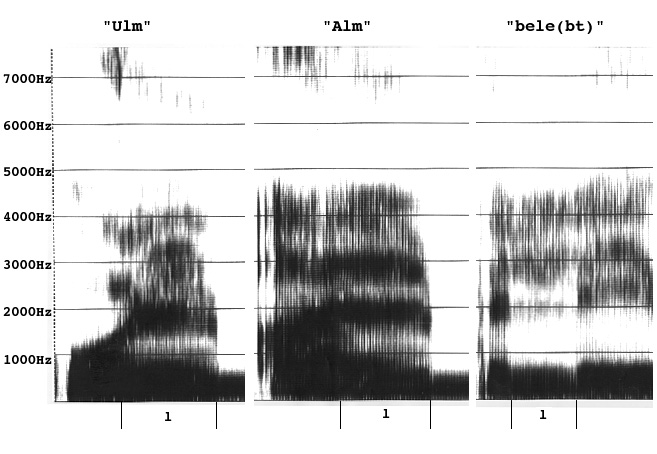
Folgevokal F1 F2 F3
u 160 - 300 Hz 1070 - 1500 Hz 2000 - 2500 Hz
o 190 - 430 Hz 950 - 1540 Hz 1900 - 2500 Hz
a 260 - 500 Hz 1130 - 1740 Hz 2200 - 2470 Hz
e 210 - 450 Hz 1300 - 1780 Hz 2260 - 2500 Hz
i 180 - 270 Hz 1310 - 2050 Hz 2240 - 2680 Hz
Zusammenfassung 160 - 500 Hz 950 - 2050 Hz 1900 - 2680 Hz
Dalston Faure
F1: 350 Hz 495 Hz
F2: 1200-1300 Hz 1015 Hz
F3: 2600-2900 Hz 2260 Hz
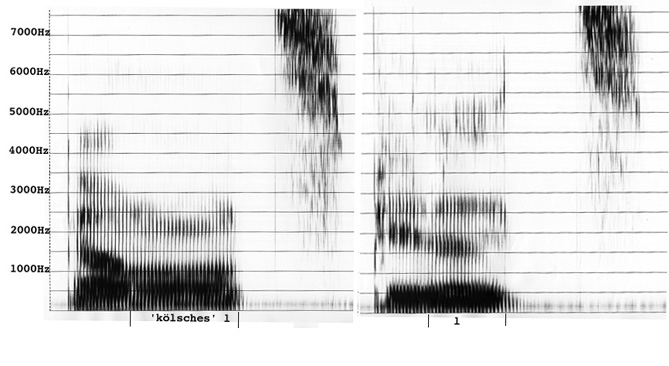
F1 = 350 Hz
F2 = 2000 Hz
F3 = 2300 Hz
F4 = 2900 Hz
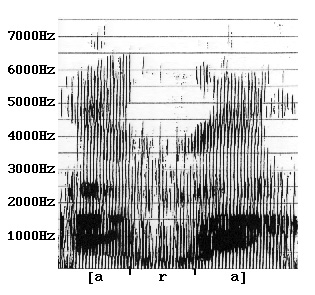
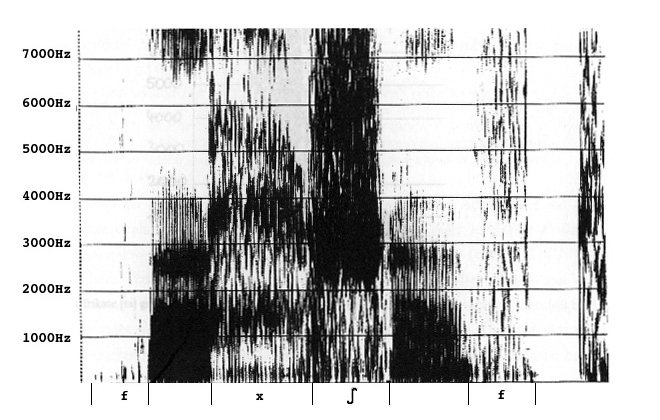
Affrikaten
Die Öffnung eines Plosivs in einen homorganen Frikativ bezeichnet man als
Affrikate. Affrikaten werden wie Frikative produziert, denen ein Verschluß
vorausgeht. Dieser Verschluß wird an derselben Stelle gebildet wie die Enge
für den Frikativteil. Der Frikativteil ist in der Regel kürzer als ein
'einzelner' Frikativ.
Im Sonagramm zeigt sich die Ausbildung des Frikativs mit zunehmender
Verschlußöffnung sehr deutlich durch eine schräg verlaufende
(meist fallende) Untergrenze des frikativen Energieschwerpunktes.
Die Abbildung 2.19 zeigt die Affrikate [ts] in der Äußerung "Zoo".